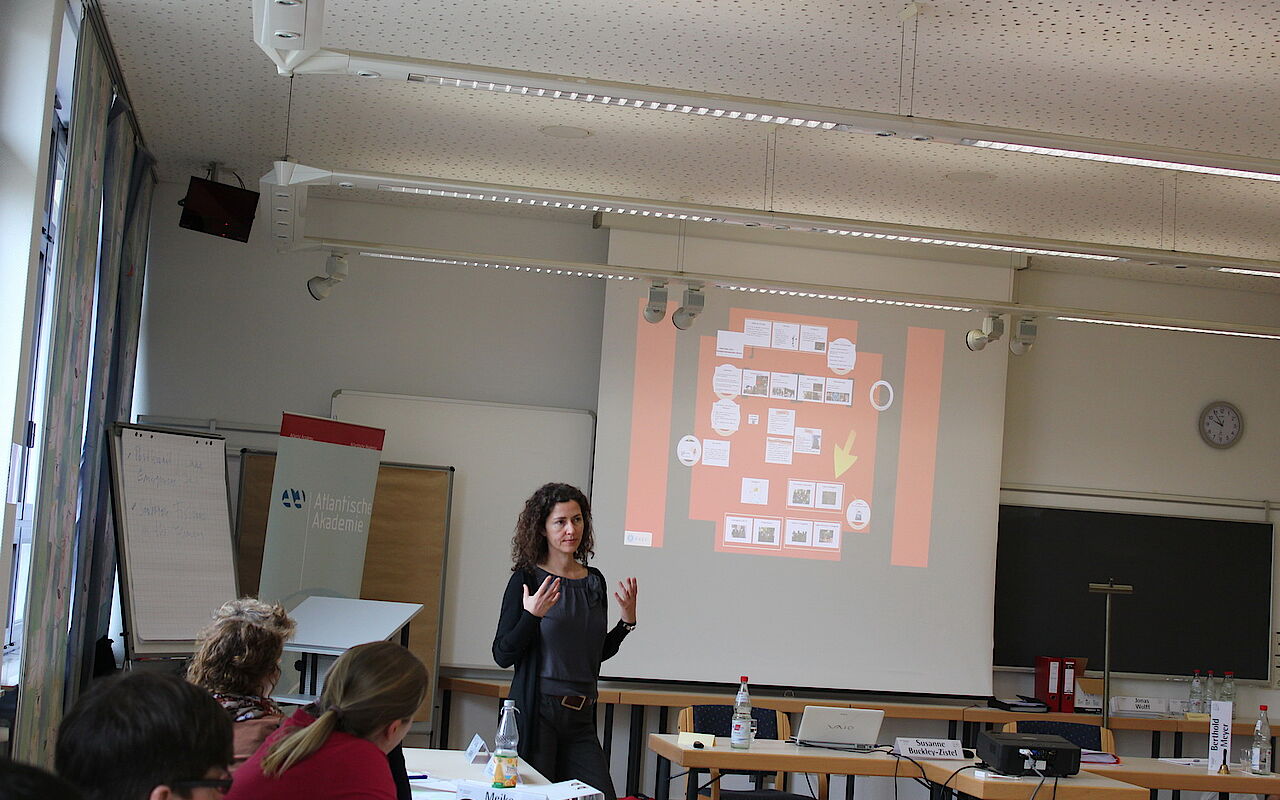Gewalt - Staatlichkeit - Demokratie - Frieden? Neue Wege der Interventionsforschung
Bericht über die 22. Frühjahrsakademie Sicherheitspolitik
11. bis 21. März 2012 Lambrecht/Pfalz und Brüssel
Berthold Meyer
In den vergangenen Jahrzehnten wurde - oft unter dem Vorzeichen einer „Humanitären Intervention" - von Einzelstaaten und Staatenbündnissen, mal mit und mal ohne Legitimation der UNO, in zahlreiche Konflikte eingegriffen. Dabei ging es entweder darum, Gewalt zwischen Bevölkerungsteilen oder von Seiten einer autoritären Regierung gegen die eigene Bevölkerung zu verhindern. Manchmal sollte auch ein fragiler Staat (wieder) funktionsfähig gemacht werden, wobei gleichzeitig Demokratie und Frieden hergestellt werden sollten. Die Erfolgsbilanzen derartige Versuche fallen gemischt aus: Gewalt konnte manchmal unterbunden werden. „State building" nach den Vorstellungen der Intervenierenden stieß hingegen des Öfteren auf wenig Verständnis bei den Betroffenen. Demokratie und Frieden scheinen Ziele zu sein, die einander eher im Wege stehen als ergänzen. Dennoch verändern Interventionen die Gesellschaften, in deren Alltag sie eingreifen, vor allem dann, wenn fremde Truppen und Zivilberater von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen längere Zeit im Lande bleiben.
Die 22. Frühjahrsakademie Sicherheitspolitik der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und des Zentrums für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg befasste sich vom 11. bis 21. März 2012 mit neuen Wegen der Interventionsforschung. In ihrem Mittelpunkt stand die Frage, wie frühzeitig, möglichst schon vor den Entscheidungen über eine Einmischung, darauf geachtet werden kann, dass über die Beendigung von Gewalthandlungen hinaus für den jeweiligen Fall angemessene politische und gesellschaftliche Organisationsformen gefördert werden können, die ein friedliches Zusammenleben dauerhaft ermöglichen. An der Akademie nahmen 23 Studierende und Doktoranden aus sieben Nationen teil. Die Veranstaltung wurde dankenswerterweise aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz, der Bundeszentrale für politische Bildung sowie von der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF) gefördert.
Der erste Teil, in dem Grundlagen geklärt werden sollten, begann mit einem Vortrag von Prof. Dr. Hanns W. Maull, Uni Trier, zum Thema „Prekäre Staatlichkeit als Herausforderung der internationalen Politik zu Beginn des 21. Jahrhunderts". In vier Schritten und zwölf Thesen entfaltete er zunächst den Kontext, wobei er die Machtexplosion menschlicher Handlungs- und Zerstörungsmöglichkeiten besonders herausstellte. Im Vergleich zu früheren Epochen habe Staatlichkeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen. „Der Staat" müsse viel mehr können als vor 200 Jahren, weil die Ausdifferenzierung der Gesellschaft einen höheren Regelungsbedarf schaffe. Deshalb stellten nicht richtig funktionierende Staaten für die eigene Gesellschaft wie für andere Staaten ein großes Problem dar. Und infolgedessen sei die vielfach anzutreffende prekäre Staatlichkeit eine Gestaltungsaufgabe für die Staatengemeinschaft.
Um einen zentralen Grund hierfür ging es im hierauf folgenden Referat von Dr. Daniel Lambach vom Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) der , der Bedeutung von Gewalt im Zusammenhang mit dem Zerfall von Staaten. Nach den Kriterien für die Entwicklungszusammenarbeit gebe es derzeit 35 bis 50 fragile Staaten auf der Welt. Probleme hätten aber viel mehr, so dass man sagen könne, „Fragilität war und ist der Normalzustand". Staatliche Fragilität erzeuge aber „gewaltoffene Räume", wobei es eine große Bandbreite von Gewaltniveaus zwischen und in kollabierenden Staaten gebe. Externe Akteure, die sich um „state building" bemühten, hätten zwar auf der Ebene der Organisationsformen relativ große Gestaltungsmöglichkeiten. Geringer seien diese schon mit Blick auf das Design des politischen Systems. Noch schwieriger sei es, auf die Legitimationsbasis des Systems Einfluss zu nehmen, und am schwierigsten auf die soziokulturellen Normen, Institutionen und Ideen.
Wenn von Aufgaben der Staatengemeinschaft mit Blick auf die Unterbindung von schwersten Menschenrechtsverletzungen innerhalb einzelner Mitgliedstaaten die Rede ist, wird seit einigen Jahren schnell von „humanitären Interventionen" gesprochen. Welches die ethischen Anforderungen an solche Eingriffe sind, behandelte Prof. Dr. Berthold Meyer vom Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg. Diese Anforderungen an die Entscheidung, ob von außen in die Souveränität eines Staates militärisch eingegriffen werden soll, seien sehr hoch. Zu ihnen gehöre zunächst das Vorhandensein eines gerechten Grundes, wie der Verletzung des „Rechtes auf Leben" oder des „Rechtes auf Rechte" für Teile der Bevölkerung, sodann die ordentliche Legitimität, die nur von den Vereinten Nationen ausgehen kann, weiterhin die Kriterien der ultima ratio, also der Feststellung, dass es keine andere Möglichkeit gebe, das Leid der Menschen zu beenden, der Angemessenheit des durch die Intervention zu erwartenden Schadens gegenüber dem von ihr verhinderten Leid, der Friedensbezogenheit und der Aussicht auf Erfolg. Nur wenn dies alles gegeben sei, verdiene eine Intervention das Prädikat „humanitär".
Anschließend erörterte Prof. Jon Western, PhD, vom Mt. Holyoke College, South Hadley, Mass., in einem zweiteiligen Referat die Haltung der USA zur „Responsibility to Protect and Humanitarian Interventions". In der ersten Hälfte analysierte er die innenpolitischen Entscheidungsprozesse in den USA in Bezug auf Humanitäre Interventionen, wobei er die Teileliten, die an diesen Prozessen beteiligt sind (z.B. „hardliner", „selective engagers", „isolationists", „pacifists"), in einem Diagramm mit den Achsen „threats" und „costs of war" einerseits und „interests" und „values" andererseits verortete. Je nach Intervention ergaben sich in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Koalitionen von Befürwortern oder Gegnern. In der zweiten Hälfte ging es um „Norms and Politics of Civilian Protection". Dabei zeigte Western auf, wie es nach dem Scheitern der UNO in Bosnien-Herzegowina und in Ruanda zur Entwicklung der „Responsibility to Protect" gekommen ist und stellte dann die Haltung der USA zu den verschiedenen Interventionen von Afghanistan bis zur aktuell diskutierten Möglichkeit eines Eingriffs in Syrien vor. Für letztere seien in dem vorher vorgestellten Diagramm nur die Repub-likanischen Neokonservativen.
Der zweite Teil der Frühjahrsakademie fragte nach Strategien der Friedens- und Demokratieförderung und den dazu bereitstehenden Akteuren. Hier trat als erster Dr. Leopold von Carlowitz vom Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, ZIF, Berlin, auf. Er behandelte das Thema „Peace keeping und Rechtsstaatsförderung" und ging dabei auch auf die „rule of law"-Trainingprogramme des ZIF ein. Innerhalb von peace keeping-Missionen ist die Rechtsstaatsförderung eine von zahlreichen gleichzeitig zu leistenden Aufgaben, was von Carlowitz an dem Organigramm einer typischen UN-Mission deutlich machte. Meist seien diese Bemühungen von einem westlichen „rule of law"-Verständnis bestimmt, das mit den Rechtsordnungen der Gastgeberländer manchmal konkurriere, manchmal kollidiere. Juristen, die selbst aus einem solchen Land stammen, aber im Westen ausgebildet wurden, hätten am ehesten die Möglichkeit, eine Brücke zwischen den Rechtskulturen zu bilden.
Im anschließenden Vortrag über „Keine magischen Waffen: Abrüstung, Demobilisierung und Reintegration in Nachkriegsgesellschaften unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterperspektive" sprach Dr. Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), Frankfurt, zunächst über die große Unsicherheit, die Nachkriegsgesellschaften kennzeichnet, woraus resultiert, dass Sicherheit dort in der Hierarchie öffentlicher Güter eine Vorrangstellung einnimmt. Deshalb komme den sogenannten DDR- oder DDRR Programmen (Disarmament, Demobilization, Reintegration wobei das zweite R für zivilberufliche Rehabilitation steht) eine große Bedeutung zu, wenngleich diese Maßnahmen kein Wundermittel seien, um Kämpfer in ein ziviles Leben zurückzuführen. Die Rolle von Frauen in diesem Zusammenhang sei vielfältig, da zwar nur wenige als Kämpferinnen und mehr als Logistikerinnen im Einsatz waren, aber alle als Familienangehörige. In den Genuss von DDR(R)-Programmen kämen sie aber im Regelfall nur, wenn sie Kämpferinnen gewesen seien, was vielen von ihnen den Aufbau ziviler Kompetenzen erschwere.
In einem weiteren Referat ging Prof. Dr. Johannes Varwick von der Uni Erlangen-Nürnberg den Fragen nach „Die UNO - Wächter? Initiator? Getriebener? Wer entscheidet über welche Art von Interventionen?" Dabei reflektierte er zunächst die Frage, wie viel Macht die UNO hat, was unterschiedlich gesehen werden kann, je nachdem, ob man sie als Instrument staatlicher Diplomatie, als Arena oder selbständiger Akteur der internationalen Politik betrachtet. Danach beleuchtete er das Zwei-Klassen-System der internationalen Friedenssicherung und die Rolle Deutschlands und sprach drei Empfehlungen aus: 1. Eine aktive(re) Rolle im Bereich des erweiterten Sicherheitsbegriffs („the other UN") sei sinnvoll. 2. Ein nüchterner Blick auf die Frage des Gewaltlegitimierungsmonopols sei notwendig. 3. Mehr Engagement im Bereich der unmittelbaren UN-Friedenseinsätze sei denkbar, um die Zwei-Klassen-Problematik abzumildern. Da einer der Teilnehmer, Thomas Mickan, selbst schon zur Problematik der UN-Einsätze publiziert hatte, war er eingeladen, in einem ausführlicheren Statement zu den Thesen Varwicks Stellung zu nehmen, worauf eine kleine Diskussion zwischen den beiden zustande kam.
In einem weiteren Vortrag in diesem Teil der Akademie setzte sich Prof. Dr. Sebastian Harnisch von der Uni Heidelberg unter der Frage „Unmanned - Unmatched?" mit der „postdemokratischen militärischen Interventionspolitik der Obama-Administration" auseinander. Im Zusammenhang mit der „Maschinisierung der Gewaltanwendung" etwa durch Drohnen, die von einem Computer-Arbeitsplatz in den USA bei ihrem Einsatz in Afghanistan gesteuert werden, verändere sich die Sozialstruktur der Internationalen Beziehungen. Die Interventionspolitik der USA habe sowohl unter George W. Bush als auch unter Barack Obama nicht intendierte Konsequenzen gezeigt: Die Konflikte eskalierten schneller und die Interventionen dauerten meist länger als gewünscht („moral hazard"), die Hegemonialrolle schwinde und die Institutionen erodierten.
Im darauf folgenden Referat stellte Prof. Dr. Susanne Buckley-Zistel vom Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg „Transitional Justice" als eine von internationalen Akteuren nach Kriegen und Bürgerkriegen angewandte Strategie vor. Zunächst führte sie dabei in das Konzept der „Transitional Justice" ein, das sich von den Nürnberger Prozessen bis zur Einsetzung des ICC stetig fortentwickelt hat. Danach verschaffte sie der Teilnehmergruppe einen Überblick über verschiedene Maßnahmen, die mit den Zielen Aufdeckung der Wahrheit über Verbrechen, Identifizierung und Zur-Rechenschaft-Ziehung von Tätern, Wiederherstellung der Würde der Opfer, Prävention zukünftiger Straftaten und Förderung von Aussöhnung und friedlicher Koexistenz angewandt werden, um schließlich deren Möglichkeiten und Grenzen am Fallbeispiel Norduganda aufzuzeigen.
Dr. Jonas Wolff von der HSFK Frankfurt hatte seinen darauf folgenden Beitrag mit „Die internationale Politik der Demokratieförderung zwischen harmonisierender Rhetorik und widersprüchlicher Praxis" überschrieben. Unter Demokratieförderung seien verschiedene Aktivitäten ausländischer Akteure zu verstehen, die in einem bestimmten Land direkt und explizit auf die Etablierung, Stärkung und Verteidigung zielen. Motiviert würden sie u.a. durch eine normative Präferenz für Demokratien und einen liberalen Missionarismus, wie er schon Woodrow Wilson zur Zeit des Ersten Weltkrieges vertrat, aber auch durch die empirisch abgesicherte Erkenntnis, dass Demokratien untereinander deutlich weniger Kriege führen als mit Nicht-Demokratien. Dieses Theorem des demokratischen Friedens ermögliche, so eine These Wolffs, eine „politische Konvergenz hinter der Demokratieförderung". Dennoch bleibe sie ein von Zielkonflikten geprägtes Unterfangen, nicht zuletzt, weil ein Eingriff von außen im Wider-spruch zum demokratischen Selbstentscheidungsprinzip stehe.
Um letzterem gerecht zu werden, wird seit den 1990er Jahren ein Konzept der „local ownership" verfolgt, durch das verhindert werden soll, dass Wertvorstellungen der Intervenierenden den Gesellschaften, in die interveniert wird, aufgedrängt werden. Dr. des. Hannah Reich von Berghof Conflict Research, Berlin, ordnete in ihren Beitrag über „Local ownership und kulturelles Bewusstsein" beides in ein produktives Konzept der Konflikttransformation ein, wobei sie den Begriff der „insider" gegenüber den „locals" bevorzugte. Sie stellte drei Dilemmata heraus: „dependency", die dadurch entstehe, dass der Aufbau von Strukturen eine nachhaltige Verpflichtung und somit Abhängigkeit von externer Unterstützung verlange; „intrusive", weil Klarheit und Entschiedenheit zum Aufbau stabiler Nachkriegsstrukturen erforderlich seien, komme es zu einer Verfremdung bei der betroffenen Bevölkerung; und „transition", die Kooperation mit lokalen Partnern bei gleichzeitiger Arbeit mit den gegebenen Machtstrukturen verlange eine Transformation dieser Strukturen. Um die vielschichtige Problematik sichtbar werden zu lassen, ließ Hannah Reich vier Arbeitsgruppen ein „conflict mapping" zu verschiedenen Konflikten vornehmen. Die dabei entstandenen Grafiken wurden anschließend im Plenum diskutiert.
Der dritte Teil der Akademie war darauf angelegt, den Blick auf verschiedene Konflikte zu lenken, in denen auf die eine oder andere Weise interveniert wurde, um zu versuchen, die jeweiligen Erfolge zu bilanzieren. Am Anfang stand eine Diskussion zwischen Dr. Florian P. Kühn von der Helmut-Schmidt Universität der Bundeswehr, Hamburg, und Dr. Markus Ritter von der Bundespolizeidirektion Kaiserslautern über das „Interventionsziel Security Sector Reform am Beispiel Afghanistans". Hierzu trug Ritter, der 15 Monate lang Leiter der bilateralen Polizeimission in Afghanistan war, zunächst vor, in welcher Weise diese ihrer Aufgabe nachgekommen ist und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert war. Immerhin seien 5.000 Polizisten pro Jahr auf diesem Wege ausgebildet worden. Er gehe davon aus, dass die von der Bundesrepublik betriebene Polizeiausbildung auch dann noch fortgesetzt werde, wenn die Bundeswehr Ende 2014 abgezogen würde. Kühn, der in Afghanistan geforscht hat, sah die dortige Sicherheitssituation nicht so positiv. Ein erhebliches Problem bei der Polizeiausbildung ergebe sich daraus, dass die Interventionsmächte selbst unterschiedliche Polizeikonzepte verfolgten: So zielten das deutsche und das EUPOL-Konzept auf eine gründliche Ausbildung, während die Interessen der USA insbesondere infolge der verschärften Sicherheitssituation auf kurze und schnelle Ausbildung ausgerichtet seien. Die Militarisierung der Polizei habe Folgen für deren Verankerung in der Gesellschaft. Es würden in einem erheblichen Umfang Gewaltakteure ausgebildet, die dann aber nicht zum Schutz der Gesellschaft insgesamt zur Verfügung stünden, sondern denen dienten, die sie besser bezahlten.
Schon während der ersten Tage der Akademie hatten die revolutionären Bewegungen in Nordafrika und im Nahen Osten, vor allem die ab März 2011 von der NATO durchgesetzte Flugverbotszone über Libyen und die sich ständig verschärfende Lage in Syrien eine Rolle in den Diskussionen über die einzelnen Vorträge gespielt. Sie wurden aber erst während des dritten Teils der Akademie ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Dr. André Bank vom GIGA Institute of Middle East Studies, Hamburg, referierte in einem ersten Vortrag über „Präsidentenstürze, Bürgerkriege, überlebende Monarchen - Die ‚Arabische Revolte‘ nach einem Jahr". Er versuchte die Entwicklungen in den verschiedenen arabischen Staaten in vier Gruppen einzuteilen, wobei er einräumte, dass dies momentan noch sehr vorläufig sein müsse, da die Prozesse noch nicht zum Stillstand gekommen seien: 1. Dort, wo es zu einem Präsidentensturz gekommen ist (Tunesien, Ägypten, mit Abstrichen Libyen) sei es zu einem Wahlpluralismus und zum Bedeutungsgewinn islamistischer Parteien gekommen. 2. Repression und Bürgerkrieg gebe es in fragmentierten Republiken (Jemen, Syrien, wiederum mit Abstrichen Libyen). 3. In den autoritären Monarchien seien die Proteste durch Zugeständnisse aufgefangen worden, so dass es zu einer vorläufigen Stabilisierung gekommen sei (Jordanien, Marokko, Golf-Monarchien mit Ausnahme Bahrein). 4. In Ländern, in denen noch vor relativ kurzer Zeit Kriege geherrscht hätten, seien die Effekte der von Tunesien ausgegangenen Revolten eher gering gewesen (Irak, Libanon, Algerien, Palästinensische Gebiete, mit Abstrichen Jemen).
In seinem zweiten Vortrag befasste sich Bank mit der Gewalt in Syrien und dem Engagement der Arabischen Liga. Zunächst zeichnete er die Entwicklung der syrischen Revolte seit Beginn der Proteste am 18. März 2011 nach, die innerhalb eines Jahres 8.000 Todesopfer und Zehntausende von Verletzten gefordert hat. Das Assad-Regime unterscheide sich insofern von dem Gaddafis in Libyen, als die Machtbasis sich auf die Familie, die Alawiten und bestimmte andere Minderheiten konzentriere, wobei es eine hohe Kohärenz in den Sicherheitsapparaten gebe, was ein Grund dafür sei, dass es bisher relativ wenige Deserteure gebe. Andererseits sei die Opposition vielfältig gespalten. Die Rolle der Arabischen Liga gegenüber Syrien sei nicht denkbar ohne ihre im Februar/März 2011 erfolgte Parteinahme der Liga gegen Gaddafi. Wichtig für das starke Engagement der Liga seien drei Aspekte: Zum einen die Dynamik des innersyrischen Konfliktverlaufs, der im Herbst 2011 zu einem „Patt" geführt habe. Zum anderen die regionale und allianzpolitische Bedeutung Syriens und das geteilte Interesse der EU, der USA und der Golfstaaten an einer Schwächung Irans mit Syrien als Teil der „Widerstandsachse gegen den westlich-israelischen Hegemon". Und schließlich die Machtverhältnisse innerhalb der Arabischen Liga, in der Qatar [im Deutschen: Katar, aber wie es beliebt] 2011/12 den Vorsitz halte. Es könne in gewisser Weise von einer Okkupation der Liga durch den Golf-Kooperationsrat gesprochen werden, weshalb es überrasche, dass Algerien und Jemen mitgezogen seien.
Prof. Dr. Thilo Marauhn, Uni Gießen, wandte sich in seinen Ausführungen dem für die Interventionspolitik der Gegenwart gern beanspruchten Wandel des Völkerrechts zu. Unbeschadet allen Wandels gelte, dass Staaten das Völkerrecht setzen, gleichzeitig Adressaten des Völkerrechts und auch diejenigen seien, die über sein Funktionieren wachen. Insofern handle es sich um ein horizontales Rechtssystem, in dem der UN-Sicherheitsrat kein Rechtsdurchsetzungsorgan sei. Die Entwicklung vom Gebot der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten aus der UN-Charta zur „responsibility to protect", die vom World Summit der UNO 2005 in seine Abschlusserklärung aufgenommen wurde, dürfe nicht als eine Selbstaufforderung der Staatengemeinschaft angesehen werden, nun in allen möglichen kritischen Situationen militärisch zu intervenieren. Inzwischen gebe es auch eine brasilianische Initiative unter dem Titel „responsibility while protecting". Die Resolution des Sicherheitsrates 1973 zur Errichtung einer Flugverbotszone über Libyen vom 17. März 2011 weise zwar genau wie die ihr vorangegangene Resolution 1970 auf die Verantwortung der libyschen Behörden hin, die Bevölkerung ihres Landes zu schützen, berufe sich aber in den Passagen, in denen es um die internationalen Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz geht, nicht ausdrücklich auf die „responsibility to protect". Zu dieser vertrat Marauhn die Auffassung, ihr Präventionsteil sei rechtlich stark verfestigt, während ihr Interventionsteil dies nicht sei.
Um die Libyen-Resolution 1973 des Sicherheitsrates ging es auch in dem anschließenden zweiten Beitrag von Prof. Dr. Berthold Meyer unter der Fragestellung „Deutschland und der Fall Libyen - ein außenpolitisches Desaster?" Die Bundesrepublik hatte sich als nicht-ständiges Mitglied des Sicherheitsrates am 17. März 2011 gemeinsam mit China, Russland, Brasilien und Indien der Stimme enthalten. Die Bundesregierung war dafür in den Medien heftig kritisiert worden, aber auch von Deutschlands NATO- und EU-Partnern zeitweilig isoliert worden. Betrachte man die Resolution 1973 näher, so hätte es nicht zu Maßnahmen kommen dürfen, die über den Schutz der Zivilbevölkerung hinausgingen, was dann faktisch doch geschah. Dies rechtfertige aber nicht nachträglich die deutsche Enthaltung, sondern zeige, dass es gerade deshalb besser gewesen wäre, wenn die Bundesregierung bei einer Beteiligung während der Aktion eine Mitsprachemöglichkeit gehabt und auch genutzt hätte, um solche Ausweitungen zu verhindern. Denn schon im Friedensgutachten 2011 sei darauf hingewiesen worden, dass die noch nicht etablierte internationale Norm der Schutzverantwortung einer doppelten Gefährdung ausgesetzt sei, „zum einen durch zu hohe Ansprüche bei mangelhafter Durchsetzung, zum ande-ren durch ihren Missbrauch" (Debiel/Goede).
Die danach folgenden Vorträge befassten sich mit den Folgen von Interventionen auf die Gesellschaften. Werner Distler, M.A., vom Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg sprach über „Interventionsgesellschaften und Interventionskultur am Beispiel des Kosovo". Aufgrund einer lang andauernden Intervention würden in der Interventionsgesellschaft Traditionen und informelle zwischenmenschliche Beziehungen verändert. Welch großen Einfluss die bloße Anwesenheit des Interventionspersonals auf eine Gesellschaft habe, lasse sich an folgenden Zahlen erkennen: Im Jahr 2000 hätte das gesamte Interventionspersonal im Kosovo 100.000 Menschen umfasst, was fünf Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Selbst 2010 waren es noch 30.000 Personen. Allein in Prizren beschäftige die KFOR 400 Einheimische, die durchschnittlich 368 € monatlich verdienen, wodurch sie weit über dem Einkommensdurchschnitt der übrigen Einheimischen lägen. Bedeutsam seien auch „nicht intendierte Effekte" der Anwesenheit des zum größten Teil männlichen Interventionspersonals, nämlich das Ansteigen der Prostitution und des Menschenhandels.
Hieran anschließend richtete Anne Menzel, M.A., Freie Universität Berlin, den Blick auf die Praxis von „transitional justice" in Sierra Leone unter den Leitgedanken „Versöhnung", „Reintegration" und „Ästhetik der Gefährlichkeit". Zu Beginn schilderte sie das Kriegsgeschehen von 1991 bis 2002, das von den Menschen in Sierra Leone insofern als „sinnloser Krieg" betrachtet werde, als er ihnen „nichts gebracht" hätte. Es war darüber hinaus ein Krieg mit „erschreckender Gewalt" und einer bis heute noch in ihrem Umfang nicht klar ermittelten Zahl von Toten, die je nach Schätzung zwischen 50.000 und 200.000 angegeben werde. Das Kriegsgeschehen wurde auf zwei Weisen aufzuarbeiten versucht. Zum einen durch eine Wahrheitskommission (TRC), die bis 2005 unter dem Motto „Tru At FoTok, But Im Nomo Go Bring Pis" (Es ist schwer, über die Wahrheit zu sprechen, aber nur die Wahrheit wird Frieden bringen) gearbeitet habe, deren „Forgive and Forget"-Ansatz aber in der Gesellschaft abgelehnt worden sei. Zum anderen durch einen „Special Court", vor dem 13 Hauptverantwortliche angeklagt wurden. Auch dies sei wegen der Schwierigkeiten der Beweisführung und der Bevölkerungsferne problematisch gewesen. Es gebe eine Nichtdiskriminierungsstrategie, nach der niemand mehr offen als „Ex-Kombattant" bezeichnet werde, doch herrsche allenthalben Furcht vor Ex-Kombattanten, was sich vor allem arbeitslose Jugendliche insofern zu Nutze machten, als sie eine „Ästhetik der Gefährlichkeit" durch ein abgerissenes Aussehen kultivierten, die es ihnen Klein- und Beschaffungskriminalität erleichtere.
Im 16. Jahr nach dem Dayton-Vertrag, der den schlimmsten der Kriege während des Zerfallsprozesses Jugoslawiens beendete, betrachtete Dr. Thorsten Gromes von der HSFK, Frankfurt, den Verlauf der internationalen Präsenz und die Perspektiven für Frieden und Demokratie in Bosnien und Herzegowina. Die erste Phase von Ende 1995 bis 1997 sei von der Absicht getragen gewesen, die damals 60.000 Soldaten umfassenden Interventionsstreitkräfte nur kurz im Land zu halten und durch rasche Wahlen normale demokratische Verhältnisse zu schaffen. Dies habe sich als illusionär erwiesen. Die zweite Phase von 1997 bis 2005 habe Bosnien und Herzegowina zu einem Semi-Protektorat mit dem Office of the High Representative (OHR) als einer Art Kontrollorgan für die demokratisch gewählten Staatsorgane gemacht. Aufgrund der seit 1999 bestehenden Aussicht auf einen EU-Beitritt sei zwar keine neue Gewalt ausgebrochen, doch sei das Land gespalten geblieben. In der jetzigen, seit 2005 andauernden Phase bemühe sich das OHR, den Status des Semi-Protektorats zurückzufahren. Doch würden die ethnisch orientierten Parteien wieder stärker. Allerdings sei die staatliche und demokratische Herrschaft weithin akzeptiert, die Bürger lebten im weltweiten Vergleich in relativem Wohlstand und hoher Bildung, doch es gebe außer im Kosovo nirgendwo mehr Aufwendungen pro Kopf für die internationale Präsenz. Das Glas sei also je nach Sichtweise „halb leer oder halb voll".
Am Ende der Lambrechter Phase der Frühjahrsakademie stand ein von Berthold Meyer vorbereitetes Simulationsspiel über die Frage, wie den Menschen in Syrien angesichts der immer schwieriger werdenden Versorgungslage in umkämpften Städten wie Homs, Hama und Deraa geholfen werden könnte. Grundlage dafür waren einerseits ein Bericht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz vom 6. März 2012, andererseits allgemeine Informationen über die Haltungen der fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, sowie Deutschlands (wegen seiner Enthaltung im Fall Libyen) und Marokkos (als Vertreter der Arabischen Liga) als Nicht-Ständige Mitglieder. Diese sieben Länder bereiteten sich in Gruppen auf die Sicherheitsratssitzung vor und versuchten danach in diesem reduzierten Rat zu einer Einigung entweder in Form einer Erklärung des amtierenden Ratspräsidenten oder gar einer Resolution zu kommen. Wichtigste Diskussionspunkte waren die Fragen, ob nur die Gewalt des Assad-Regimes oder auch die der Opposition kritisiert werden solle, sowie unter welchen Bedingungen humanitäre Korridore eingerichtet werden könnten. Hierzu kamen die Vertreter auch zu einer allgemein gehaltenen Entscheidung.
Danach fuhr die Gruppe am 19. März nach Brüssel, um dort am 20. März mit je zwei Vertretern der NATO und der EU-Kommission über eine Reihe von Fragen zur Interventionspolitik zu sprechen, die von den Teilnehmern am Beginn der Akademie in zwei Arbeitsgruppen vorbereitet und nach einer Beratung im Plenum an die beiden Institutionen gemailt worden waren.
In Brüssel tagte die Gruppe am 20. März zunächst in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, wo Katrin Hagemann vom „European External Action Service" über „EU-Außenbeziehungen und EU Krisenmanagement" sprach. Das Krisenmanagement der EU sei geprägt von der Erfahrung des Bürgerkriegs in Jugoslawien und dem Massaker von Srebrenica. Doch nach der anfänglichen Betonung der militärischen Komponente der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU habe nun die zivile Hilfe an Bedeutung gewonnen. Diese zivile Seite wollen die Mitgliedsstaaten der EU aber nicht der Kommission überlassen, und so habe der Rat eigene Strukturen für die Außenbeziehungen aufgebaut. Beide Bereiche müsse man nun zusammenführen, was nicht unproblematisch sei. Doch die Krisen warteten nicht, so die Referentin. Man müsse gleichzeitig das Autorennen fahren und das Auto bauen, was sich als sehr schwierig herausgestellt habe.
Anschließend berichtete tätig war, über die Erfahrungen beim Aufbau rechtstaatlicher Strukturen in Afghanistan. Ihr Vortrag stellte eine sehr interessante Ergänzung zum dem Beitrag von Dr. Markus Ritter von der Bundespolizeidirektion Kaiserslautern über die in deutscher Regie betriebene Polizeiausbildung dar. Während sich die deutsche Mission auf die Polizeiausbildung konzentriert habe, enthalte die EU-Mission weitere zum Aufbau rechtstaatlicher Strukturen notwendige Komponenten wie die Korruptionsbekämpfung. Die EU-Berater sähen sich mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert wie der mangelnden Rechtskenntnis der Afghanen, fehlender Professionalität im Justizsystem, unzureichender geographischer Abdeckung und fehlendem Vertrauen der Bevölkerung in das Rechtssystem aufgrund von Mängeln im Vollzug. Das führe zu einer Hinwendung zu informellen oder kriminellen Systemen der Streitschlichtung, so Ryan, was wiederum ein gemischtes Rechtssystem zur Folge habe und den Taliban Chancen eröffne. Der Staatsaufbau in Afghanistan sei eine langfristige Aufgabe, so Janette Ryan, deshalb sei ein vollständiges Ende der Mission in 2014 eher unwahrscheinlich.
Am Nachmittag war die Gruppe zu Gast im NATO-Hauptquartier, wo man sich auf den Besuch des Bürgermeisters von Chicago, Ralph Emanuel, aus Anlass des bevorstehenden NATO-Gipfels vorbereitete. Auch die beiden Vorträge standen unter dem Eindruck des NATO-Gipfels. Dr. Knut Kirste, Policy Advisor im Policy Planning Unit des NATO-Generalsekretärs stellte ein neues Paradigma für die NATO vor, die „post operational alliance" mit einem stärkeren Akzent auf Prävention und „resilience". In Chicago müsse eine Antwort auf die Finanzkrise gefunden werden. Angesichts der geringer werdenden Mittel müsse man sich auf „smart defence" konzentrieren und die Ambitionen zurückschrauben, u.a. durch Setzen von Prioritäten, Zusammenarbeit und Spezialisierung. Auf die NATO-Intervention in Libyen angesprochen, betonte Kirste, dass man den Schwerpunkt nun auf Programme lege, die Interventionen verhindern sollen. Zwar könne die NATO auch weiterhin Operationen durchführen, doch man sehe sich nicht als Weltpolizist. Weder der Einsatz in Afghanistan noch der in Libyen sei ein Muster für die Zukunft. Anschließend stellte Dr. Philipp Wendel, Pressereferent der deutschen NATO-Vertretung die deutschen Kernthemen im Bündnis vor. Als erstes Thema nannte er das Verhältnis der NATO zu Russland, das nach vielen Höhen und Tiefen zahlreiche Felder für Zusammenarbeit aufweise. Weiterhin gehe es den Deutschen um Abrüstung der substrategischen Nuklearwaffen. Beim geplanten Raketenabwehrsystem der NATO legten die Deutschen Wert darauf, dass die Abschreckungsfähigkeit Russlands nicht beeinträchtigt werde. Was die „responsibility to protect" angehe, so seien solche Operationen nur mit einem klaren Mandat der UNO denkbar. Die NATO werde sich nicht aufdrängen, so Wendel, könne aber auf Anfrage Beiträge leisten. Für Afghanistan prognostiziert er, dass die Karzai-Regierung weiterhin Unterstützung benötige und Bundeswehrpersonal auch nach 2014 in Afghanistan präsent sein werde.
Schließlich hatten die Gruppe abends noch ein abschließendes Gespräch mit dem Brüsseler Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dr. Nikolas Busse, der journalistisch-kritische Anmerkungen zu dem machte, was man tagsüber zum neu gebildeten Auswärtigen Dienst der EU gehört hatte. Spannend war auch zu hören, wie die Deutschen angesichts der Finanzkrise in Brüssel gesehen werden.
Die Frühjahrsakademie wurde von Prof. Dr. Berthold Meyer, Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg, sowie von Wolfgang Tönnesmann und Dr. David Sirakov, Direktor und Studienleiter der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern, geleitet.