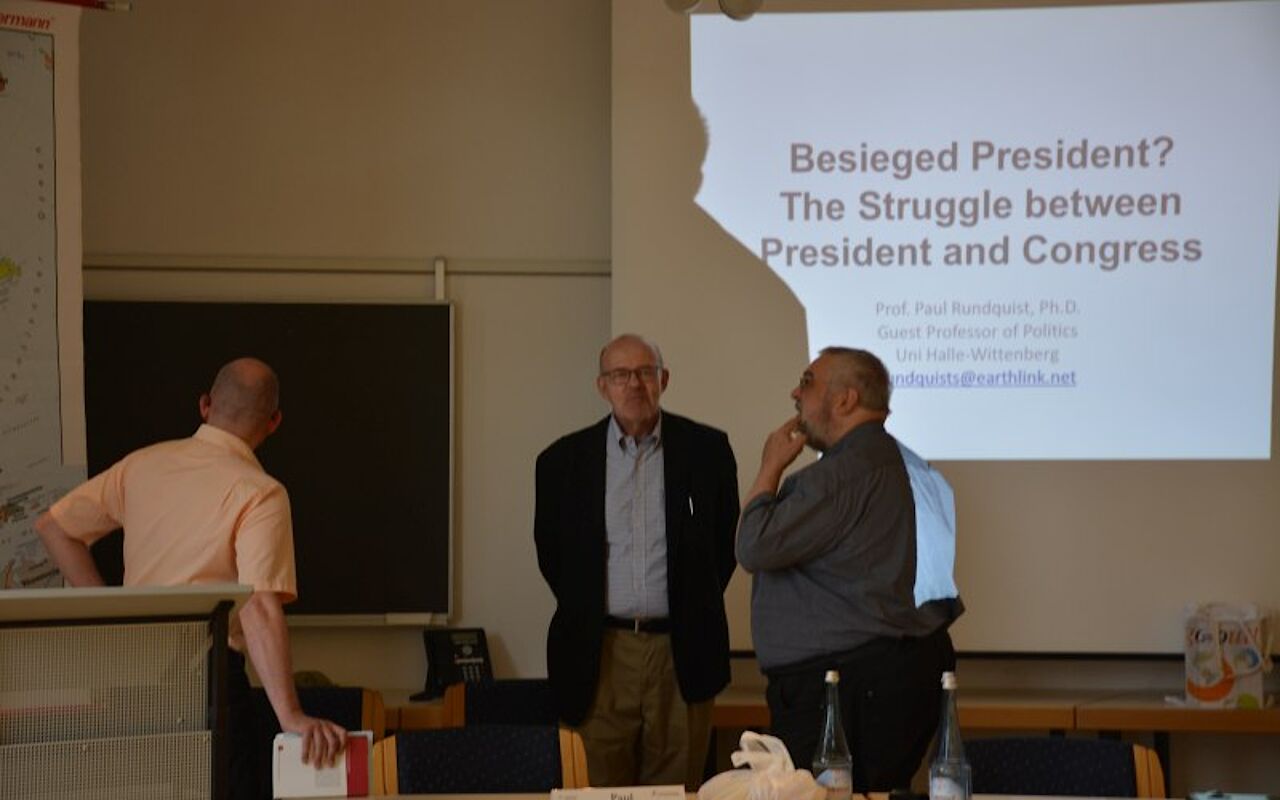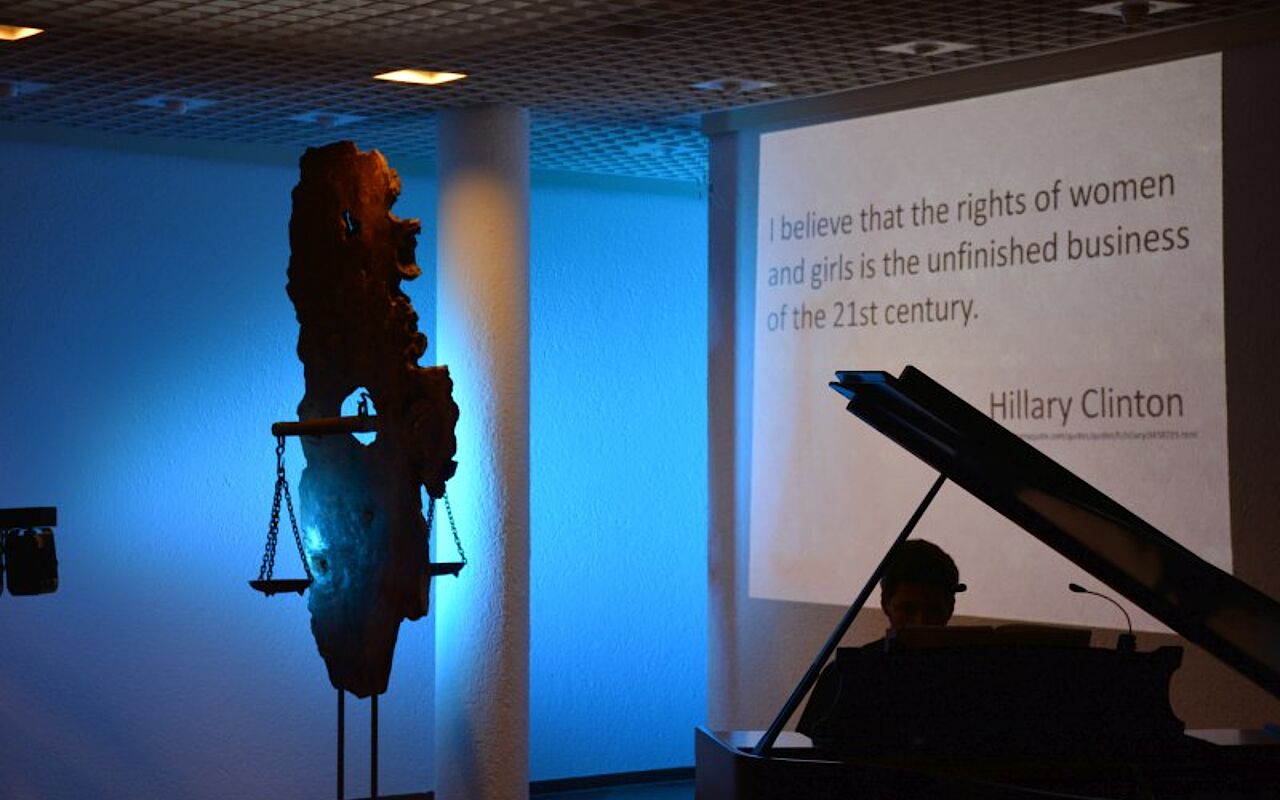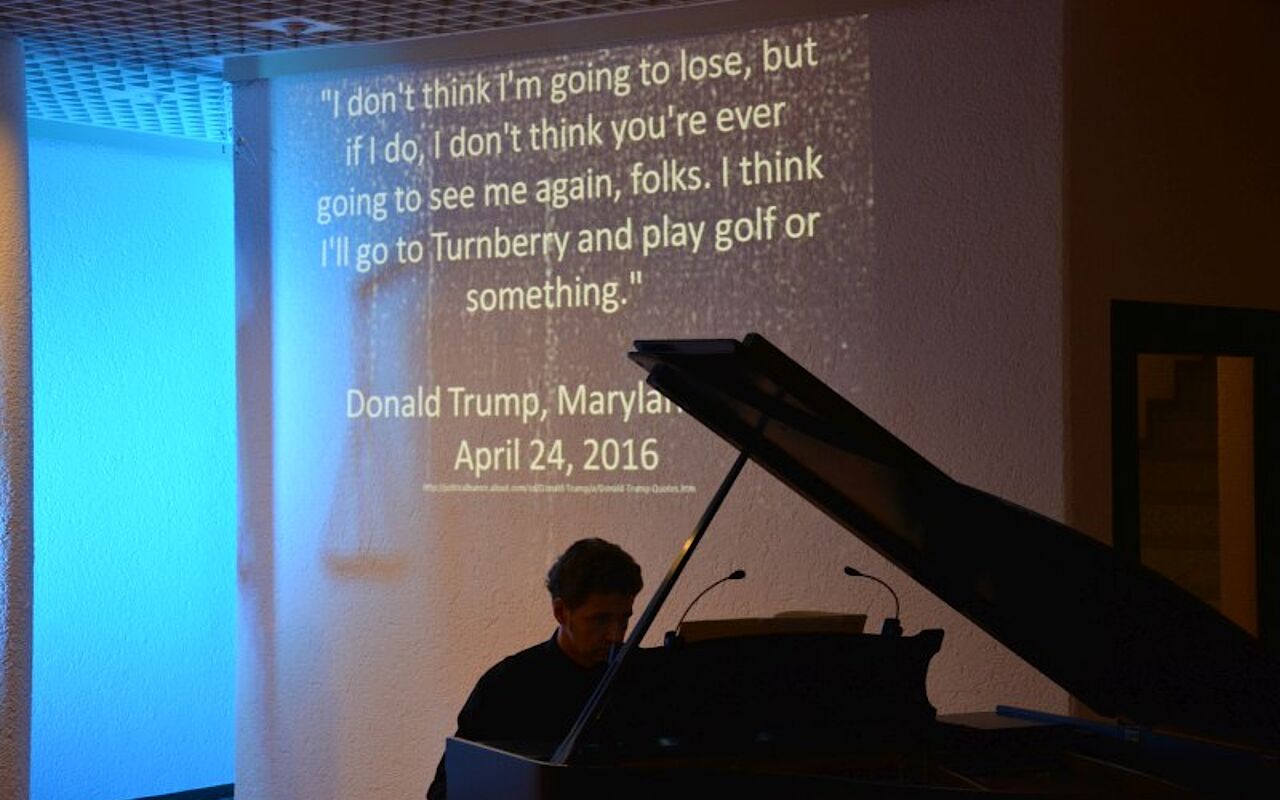Bericht von Peter Boswell (Praktikant)
Alle Jahre wieder finden sich Studierende, Studierte der Politikwissenschaft und politisch Interessierte in Lambrecht zusammen, um die neuesten Entwicklungen amerikanischer Politik zu diskutieren. Das Wahljahr 2016 bot hierzu natürlich genügend Gesprächsstoff: Ein exzentrischer Donald Trump schwingt Phrasen zu Migration und Einwanderung, während Hillary Clinton sich gegen ihren demokratisch-sozialistischen Kontrahenten Bernie Sanders behaupten konnte. Der amerikanische Kongress scheint gelähmt wie noch nie und politische Entscheidungsfindung liegt vor allem in der Hand des 44. Präsidenten, Barack Obama. Neue Militäreinsätze in Syrien haben nachhaltige Auswirkungen auf das Ansehen der USA im Allgemeinen und der US Regierung im Speziellen – innen-sowie außenpolitisch. Quo vadis, Amerika? Dies wird die entscheidende Frage sein, die sich viele amerikanische Wählerinnen und Wähler am 8. November 2016 stellen werden. Neben hörenswerten Vorträgen und hitzigen Diskussionen sorgte eine Exkursion zur Ramstein Air Base sowie ein Klavierkonzert des Pianisten Jens Barnieck aus Wiesbaden für eine spannende Ergänzung des Programms.
Den Auftakt der Summer School machten Dr. David Sirakov von der Atlantischen Akademie und Dr. Florian Böller von der Technischen Universität Kaiserslautern, die den 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick des diesjährigen Programms gaben. Nach einer kurzen Begrüßung kamen sie zum Kernelement der diesjährigen Summer School, der zunehmenden Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft und Politik. Hierzu zeichnete Dr. Böller einen Teufelskreis aus wachsender Verunsicherung, Polarisierung, fehlender Kompromissbereitschaft und Gridlock auf, welcher im Umkehrschluss zu weiterer Verunsicherung führte. Diese Verunsicherung werde vor allem durch das Misstrauen gegenüber der amerikanischen Politik deutlich: Gerade einmal 19 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner hätten großes oder sehr großes Vertrauen in ihre gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter. Während der proportionale Anteil der moderaten Wählerschaft kontinuierlich schrumpfe, gingen vor allem jene Bürgerinnen und Bürger zur Wahlurne, die sich mit extremen politischen Positionen identifizieren können. Dies führe wiederum zu fehlender Kompromissbereitschaft in der Legislative, da diese sich vor ihrer Wählerschaft im Wahlkreis, nicht aber auf Bundesebene, verantworten müsste – im Umkehrschluss befinde sich das System im politischen Gridlock, bei dem vor allem das Wohl der Bürgerinnen und Bürger auf der Strecke bleibe.
Im Anschluss trat Prof. Dr. Michael Dreyer von der Friedrich-Schiller Universität Jena an das Podium und hielt einen Vortrag zur US-Verfassung und Gewaltenkontrolle im amerikanischen politischen System. Das Verfassungssystem der Vereinigten Staaten finde in den Dokumenten der Gründerzeit seine Festlegung, welche vor allem die Declaration of Independence von 1776, die Articles of Confederation von 1777/1781, die Verfassung von 1787 und die Bill of Rights von 1789/1791 umfassen. Im Great Compromise zwischen dem Einkammersystems des New Jersey Plans und des bikammeralen Systems des Virginia Plans sei eine Einigung auf ein bikamerales System erwogen worden, so Prof. Dreyer, indem beide Kammern gleiche Rechte besitzen, wobei die eine Kammer von den Bundesstaaten, die andere in Wahlkreisen gewählt würden. Herausragend für die damalige Zeit sei ebenfalls das System der Gewaltenkontrolle gewesen, das der Legislative, Exekutive und Judikative bestimmte Ernennungs-und Vetorechte einräumte. Auch gesellschaftliche Auswirkungen der Verfassung wurden aufgezeigt: So betonte der Referent die Rolle der Verfassung für den amerikanischen Gründungsmythos, für die sogenannte Civil Religion, den gesellschaftlichen Pluralismus, die politische Kultur, die Kontinuität der Verfassung durch die Jahrhunderte und die Bedeutung der Religion in den Vereinigten Staaten.
Als nächstes warf Philipp Weinmann, M.A., von der Universität Freiburg einen kritischen Blick auf das amerikanische Wahlsystem. Charakteristisch für die Vereinigten Staaten seien die fehlenden nationalen Standards auf Bundesebene. Stattdessen würden viele Einzelheiten wie etwa Wahlmethode, Design der Stimmzettel, Einteilung der Wahlkreise oder auch das Wahlrecht für Gefängnisinsassinnen und Gefängnisinsassen von den Bundesstaaten geregelt. Im Gegensatz zu anderen Demokratien steche zudem die dezentrale Organisation der Parteien hervor: Somit bestünde keine formelle Mitgliedschaft in den Parteien, keine effektive Kontrolle über die Kandidatenauswahl und keine Disziplinierungsmöglichkeiten durch die Partei. Aus diesen Gründen unterscheide sich der Nominierungsprozess der Präsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten erheblich zwischen den Parteien. Während die Staaten das Datum der Nominierung festlegten, entschieden die Parteien über die Anzahl der Delegierten pro Staat, ihre Ernennung oder Wahl sowie ihre eventuelle Wahlgebundenheit. Da die Delegierten des Electoral College nach Bundesstaaten und Mehrheitswahlrecht gewählt würden, konzentriere sich der Wahlkampf nach der Ernennung der Kandidatinnen und Kandidaten vor allem auf politisch umstrittene Staaten, die sogenannten Battleground States. Das relativ offene Wahlsystem der USA berge Vor-und Nachteile, so der Referent: Zwar sei es allen in den USA geborenen Staatsangehörigen möglich, für eine Partei anzutreten, und die Beteiligungsmöglichkeiten der Wählerinnen und Wähler stelle sich insgesamt sehr ausgeweitet dar, jedoch führe dies auch zu langen, teuren und medial aufgeputschten Wahlkämpfen, die Raum für Populismus auf beiden Seiten gewährten.
Zu Beginn des zweiten Seminartages nahm sich Dr. Christoph Haas von der Universität Freiburg dem Wahlverhalten der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner an. Zunächst wurde hierzu ein theoretischer Hintergrund zu Wahlverhalten gelegt. Dabei verwies der Referent vor allem auf den sozialpsychologischen Ansatz nach Angus Campbell. Nach diesem Modell, welches auch Ann-Arbor-Modell genannt wird – prädestinierten Makrofaktoren wie etwa sozialer Status, familiäres Umfeld oder soziologische Merkmale das Individuum für eine bestimmte Parteiidentifikation. Im Wahljahr werde diese durch Beurteilung der Kandidatinnen und Kandidaten und Bewertung politischer Themen zwar modifiziert, dies habe allerdings nur selten signifikante Auswirkungen auf die Wahlentscheidung. Somit stelle sich die Frage, welche Bevölkerungsgruppen sich vorwiegend mit welcher Partei identifizieren. Wählerinnen und Wähler der Republikaner seien vor allem männlich, höheren Alters, weiß, protestantisch, besäßen einen mittleren Bildungsgrad und verfügten über ein überdurchschnittliches Einkommen, so Dr. Haas. Im Umkehrschluss seien demokratische Wählerinnen und Wähler vorwiegend weiblich, jung, gehören ethnischen und religiösen Minderheiten an, verfügten über einen niedrigen oder sehr hohen Bildungsabschluss und ein unterdurchschnittliches Einkommen. Bei den Wechselwählerinnen und -wählern entschieden schließlich vor allem die Themen, die die Präsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten ansprechen. Hierbei stünden in diesem Jahr ökonomische Themen, Einwanderungspolitik sowie die Gesundheitsreform im Vordergrund. Dabei sei bezeichnend, dass beide Kandidaten die Höchstwerte in der Unbeliebtheit seit der Präsidentschaftswahl von 1992 erhielten.
Daran anknüpfend setzte Dr. David Sirakov von der Atlantischen Akademie die Vortragsreihe mit dem Thema der politischen Polarisierung fort. Die Ursache des politischen Gridlocks im amerikanischen Kongress liege zunächst in den unterschiedlichen Mehrheiten im Weißen Haus, im Repräsentantenhaus und im Senat seit 2011. Seither sei ein Rückgang der verabschiedeten Gesetze und der parteiübergreifenden Entscheidungsfindung zu verbuchen. Kompromisse stellten zunehmend eine Seltenheit dar. Misst man die politische Ausrichtung des Abstimmungsverhaltens der Kongressabgeordneten, so entstehe eine zweigipflige Kurve auf liberaler und konservativer Seite –ein eindeutiger Hinweis für eine zunehmende Polarisierung und eine abnehmende Überlappung in der politischen Mitte. Doch was sind die Ursachen für diese zunehmende Polarisierung? Hierbei betrachtete Dr. Sirakov vor allem die Wechselwirkung zwischen Politik und Gesamtgesellschaft. Auf politischer Seite verursachten eine stärkere Gruppengeschlossenheit und der Zugewinn von Macht in der Parteispitze einen zunehmenden Rechtsruck bei den Republikanern im Repräsentantenhaus. Der weitverbreiteten Behauptung, dass die Neuziehung von Wahldistrikten – das so genannte Gerrymandering – entscheidend für den Anstieg der Polarisierung sei, widersprach der Referent und verwies dabei auf eine Vielzahl von Untersuchungen. Verkürzte Sitzungszeiten, der Wechsel sehr konservativer Abgeordneter in der US-Senat sowie der übermäßige Gebrauch des Filibusters zur Blockade von Gesetzesentwürfen trügen ihr Übriges in der zweiten Kammer des US-Kongress bei. Gesamtgesellschaftlich seien zwar kaum Polarisierungstendenzen zu beobachten, so der Referent. Unter Parteisympathisantinnen und -sympathisanten, der Wahlbevölkerung und schließlich den politischen Aktivistinnen und Aktivisten wachse die Polarisierung aber sehr stark an. Geographical Sorting, also die zunehmende Konzentration bestimmter politischer Gruppen auf bestimmte Wahlkreise verstärke diese Tendenz noch weiter. Obwohl ein funktionierender Kongress dringend von Nöten wäre, müsse man ein Fortsetzen des Partisan Warfare auch im 115. Kongress der Vereinigten Staaten erwarten, so Dr. Sirakov.
In seinem englischsprachigen Vortrag ging Prof. Paul Rundquist von der Universität Jena auf das gestörte Verhältnis zwischen Präsident Obama und dem amerikanischen Kongress ein. Zwei hauptsächliche Gründe wurden genannt, warum Obama die Durchsetzung seiner politischen Agenda schwerfalle. Zum einen sei es ein Irrglaube, dass der Präsident durch die Verfassung die größte Macht zugesichert bekomme. Stattdessen sorgten die Gewaltenteilung und die asymmetrischen Wahlzyklen für eine effektive Kürzung des präsidialen Einflusses auf die Gesetzgebung. Zum anderen seien Gründe in den neueren Entwicklungen des US-Kongresses zu suchen. Insbesondere seit den 1990er Jahren könne man eine verschärfte Form des Partisan Warfare von Seiten der Republikanischen Partei beobachten. Statt Zusammenarbeit komme es zu vermehrten verbalen Angriffen gegen Präsident Obama, verbunden mit der Überzeugung, dass jeder Erfolg der Demokratischen Partei im Kongress ein Erfolg für Obamas Präsidentschaft darstelle. Als Konsequenz bleibe Obama noch ein Mittel, um seine Agenda durchzusetzen: Die Verabschiedung von Executive Orders, die von nachfolgenden Präsidenten oder Präsidentinnen allerdings jederzeit aufgehoben werden könnten.
In seinem zweiten Vortrag widmete sich Prof. Dreyer dem obersten Verfassungsgericht der Vereinigten Staaten. Dabei widmete er sich auch dem Tod des Justice Antonin Scalia und der bislang fehlenden Nachfolge. Trotz der Nominierung von Merrick B. Garland bleibe eine Bestätigung durch den Kongress auch vier Monate später noch aus – wiederum eine Folge der Polarisierung in der Legislative. Um auf die näheren Gründe dieser Verweigerung einzugehen, beleuchtete der Referent die Organisation und Zusammensetzung des Supreme Court. Die Verfassungsrichterinnen und -richter würden vom US-Präsidenten auf Lebenszeit ernannt, verfügten allerdings über das Recht auf freiwilligen Rückzug von ihrem Amt. In der Regel würden Richterinnen und Richter ernannt, die mit der politischen Position des Präsidenten übereinstimmen. Die Ernennung des moderaten Garlands könne somit auch als ein Appeasement Obamas gegenüber den Republikanern gesehen werden. Von den acht verbleibenden Richterinnen und Richtern wurden vier von Republikanern und vier von Demokraten ernannt, der verstorbene erzkonservative Richter Scalia habe somit das Zünglein an der Wage zu Gunsten der Republikanischen Partei gebildet. Somit wird schnell klar, dass machtpolitische Erwägungen eine entscheidende Rolle in der Blockade Garlands als neuen Verfassungsrichter spielen sollten.
Nachdem Themen zu politischem System und Verfassung der Vereinigten Staaten hinlänglich beleuchtet wurden, startete der Mittwoch mit einem Vortrag von Dr. Curd Knüpfer von der Freien Universität Berlin zum Mediensystem der USA. Hier wurde der Fokus auf den Einfluss der Medien auf die politische Meinungsbildung der US-Bevölkerung gelegt. In den letzten Jahrzenten habe der Informationsfluss der Medien kontinuierlich zugenommen. Beigetragen hätten hierzu vor allem die Diversifizierung und Fragmentierung privater Nachrichtensender, als auch die Entstehung und Verbreitung von Online-Nachrichten. Zweierlei Auswirkungen dieser Entwicklung wurden im Vortrag aufgezeigt. Zum einen sei eine abnehmende Qualität des Journalismus in den USA zu verbuchen. Aufgrund des kompetitiven Medienmarktes komme es zu Kosteneinschnitten in der Produktion und tiefgehende Recherche werde zunehmend durch die Aufbereitung schon vorhandener Informationen ersetzt. Zudem rufe die zunehmende Pluralität der Medien eine Sensationsberichterstattung hervor, um Zuschauerinnen und Zuschauer anzusprechen. Der zweite große Trend finde bei den Zuschauerinnen und Zuschauern selbst statt: Zwar bestehe ein breit gefächertes Angebot an Informationsquellen aller politischen Färbungen, allerdings würden oftmals nur jene Nachrichtenseiten zur Meinungsbildung herangezogen, die die eigene politische Überzeugung widerspiegelten. Soziale Medien verstärkten diesen Trend zusehends, da diese automatisch solche Nachrichtenbeiträge vorschlügen, die dem eigenen Geschmack entsprechen.
Ebenfalls von der FU Berlin trug Prof. Dr. Boris Vormann als nächstes zur ökonomischen Lage der Vereinigten Staaten im Wahljahr vor. Hierzu wurde die ideengeschichtliche Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften seit dem Ende des Kalten Krieges näher begutachtet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion herrsche das neoliberale Dogma, dass das Ende der Geschichte erreicht sei und keine ernsthafte Bedrohung freier Märkte mehr bestehe. Spätestens seit den Finanz-, Weltwirtschafts- und Staatsschuldenkrisen vom Jahr 2007 an sei diese Ideologie erheblich in Kritik geraten – auch in den USA. Donald Trump und Bernie Sanders seien Sinnbilder hierfür, allerdings aus konträren politischen Gesichtspunkten. Sanders Befürworterinnen und Befürworter stünden in der Tradition der Occupy-Bewegung und forderten eine egalitärere Verteilung des Vermögens, eine Anhebung des Mindestlohns, einen flächendeckenden Wohlfahrtsstaat sowie eine Reduzierung der Studiengebühren. In diesem Sinne sehe Sanders sich der Sozialdemokratie und dem demokratischen Sozialismus verbunden. Trump hingegen identifiziere den Feind nicht in ökonomischer Ungleichheit, sondern vor allem im Ausland. Seine starken merkantilistischen Tendenzen manifestierten sich in einer rigorosen Abschottungspolitik gegenüber Einwandererinnen und Einwanderern aus Lateinamerika, der Forderung nach Handelsbarrieren, speziell gegen China, sowie gegen ein vermeintliches Netzwerk politischer und wirtschaftlicher Eliten. Als Fazit ließe sich ziehen, so Dr. Vormann, dass selbst wenn Hillary Clinton zur Präsidentin gewählt würde, ein Richtungswechsel in der ideologischen Einstellung der amerikanischen Bevölkerung kaum zu verhindern sei.
Den nächsten Part übernahm Dr. Henriette Rytz zum Thema Einwanderung, ein besonders prekäres Thema im Wahljahr. Schnell wurde deutlich, dass sich die USA in einem ideologischen Spannungsverhältnis befinden. Einerseits handele es sich bei den Vereinigten Staaten traditionell um ein Einwanderungsland, andererseits kochten gerade im jetzigen Wahlkampf xenophobe Meinungen im konservativen Lager hoch. Dies sollte nicht als neue Entwicklung missverstanden werden. Historisch habe es immer wieder Ausgrenzungen und Quoten gegen bestimmte Einwanderungsgruppen gegeben, sei es gegen Irinnen und Iren, Chinesinnen und Chinesen oder Jüdinnen und Juden. Inwieweit fremdenfeindliche Meinungen in Zukunft von politischer Bedeutung seien, sei fraglich, da die demografische Entwicklung in den Vereinigten Staaten eine ethnische Diversifizierung aufweise. Laut Prognosen sollten bis zum Jahr 2050 weiße Bürgerinnen und Bürger weniger als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen. Schon heute entwickelten sich Latinos zu einer entscheidenden Wählerschaft. Als Faustregel werde berechnet, dass mindestens 40 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe nötig seien, um die Präsidentschaftswahl für sich zu entscheiden. Aufgrund Trumps ablehnender Haltung gegenüber Latinos stehe dessen Wahlerfolg in diesem Punkt in Frage, so Dr. Rytz.
Anschließend ging Dr. Simone Müller von der Universität Freiburg auf den Gegensatz zwischen Umwelt-und Energiepolitik in den USA ein. Dabei stellte sie eine historische Perspektive auf die mangelhaften Umweltpolitik der Vereinigten Staaten vor. Obwohl es sich bei den USA um den weltweit größten Energie-und Stromproduzenten handele, spielten erneuerbare Energien eine zu vernachlässigende Rolle. Gerade einmal 8-10 Prozent des Energieverbrauchs in den USA würden durch erneuerbare Energien gedeckt. Einer der Hauptgründe hierfür ist das beständige Bestreben der Vereinigten Staaten nach unabhängiger Energieversorgung, welches von einem kulturellen Narrativ der Energieabhängigkeit gestützt wird. Der Ressourcenreichtum der USA in den Bereichen Erdöl und Kohle und die damit verbundenen Arbeitsplätze seien schlagkräftige Argumente gegen den Ausbau erneuerbarer Energien. Die fehlende Kontrolle von Umweltstandards auf staatlicher Seite in Kombination mit der Übermacht des Energieministeriums verstärke diese Tendenz. Der zunehmende Energieverbrauch in Entwicklungsländern führe zudem zu einer ablehnenden Haltung der USA gegenüber internationalen Umweltstandards. Obwohl Obama mit dem Clean Power Plan aus dem Jahr 2015 einen Versuch gewagt habe, den Kohlendioxidausstoß innerhalb von 25 Jahren um etwa ein Drittel zu senken, sei eine gesetzliche Regulierung von Umweltstandards fraglich – somit werde Energiepolitik wohl auch weiter in den Händen von Corporate und Consumer Responsibility liegen.
Auf der Fahrt zur Ramstein Air Base erörterte Marcus Müller, M.Ed., von der TU Kaiserslautern deren außen- und sicherheitspolitische Bedeutung. Dabei thematisierte er die Entstehungsgeschichte, ihre Rolle bei den geheimen CIA-Flügen im Zuge des Kampfes gegen den Terrorismus‘ in der Administration George W. Bushs und der Drohnenkriegsführung der Obama-Administration. Die Ramstein Air Base stelle den größten Militärflughafen außerhalb der USA dar und beheimate eine Vielzahl von Kommandos. Spezielle Bedeutung habe Ramstein als Hauptquartier des NATO Allied Air Command erlangt. In den letzten Jahrzehnten habe sich die Kontroverse um den Militärstützpunkt zusehends entfacht. Dem liege vor allem die Nutzung Ramsteins als Drehscheibe für CIA-Geheimflüge zugrunde, dem auch der deutsche Staatsbürger Khalid al-Masri oder der in Deutschland lebende Murat Kurnaz zum Opfer fielen. Darüber hinaus sei die Air Base als Knotenpunkt zwischen den Vereinigten Staaten und den Drohneneinsätzen in Nahost und Afrika von zentraler Bedeutung. Während US-Bürger dem Einsatz von Drohnen im Ausland eher neutral gegenüberstünden, gebe es unter den NATO-Partnern vermehrten Widerspruch gegen die Nutzung von Drohnen zur Terrorismusbekämpfung. Insbesondere das Völkerrecht und das Verfassungsrecht der USA würden durch Drohneneinsätze außer Kraft gesetzt und ließen eine rechtliche Grundlage vermissen.
Den ersten außenpolitischen Vortrag übernahm Prof. Dr. Jürgen Wilzewski von der TU Kaiserslautern mit einem Referat über Obamas imperiale Präsidentschaft. Durch die gesamte Präsidentschaft Obamas lasse sich ein rhetorischer Faden ziehen der eines immer wieder bestätige: Obama versuche als Exempel für die Vormachtstellung von Recht und Gesetz zu stehen, größtmögliche Transparenz walten zu lassen und Zurückhaltung bei Auslandseinsätzen zu üben. Dieses Narrativ kritisierte der Referent in seinem Vortrag vehement. In Bezug auf Schlesingers Merkmale einer imperialen Präsidentschaft, habe Obama die exekutive Kriegsvollmacht an sich gerissen und ohne Zustimmung der Legislative Auslandseinsätze in Libyen geführt. Besonderer Fokus lag auch auf den Drohneneinsätzen der USA, die in einem klaren Spannungsverhältnis zur Demokratie stünden, insbesondere wenn die parlamentarische Kontrollfunktion fehle. Allerdings sei Obama nicht die alleinige Schuld an moralisch fragwürdigen Entscheidungen amerikanischer Außenpolitik zu geben, so Prof. Wilzewski: Der Kongress verhindere die Schließung des Gefangenenlagers in Guantanamo konsequent. Insgesamt stünden die USA vor großen Herausforderungen: Insbesondere der fehlende institutionelle Konsens, die privilegierte Position bürokratischer Akteure des Sicherheitsstaates, die wachsende Macht der Exekutive und die andauernden Militäreinsätze der USA seien dabei im Vordergrund zu sehen.
Dr. Hauke Feickert von der Universität Marburg hielt einen Vortrag zur Rolle der USA im Anti-Terror- und Nahost-Konflikt. Zunächst stellte der Referent die verschiedenen Positionen von Trump, Clinton und Obama dar. Trumps Strategie könne dem des Buck Passing, also dem Abwälzen von Verantwortung auf andere Akteure zur Bekämpfung des IS, zugeordnet werden. Dabei spielten insbesondere Russland und der Iran eine Rolle. Im Gegensatz dazu sei Clintons Ansatz stark von Interventionismus geprägt, da sie eine Rollback-Strategie vorschlage und sich die Hilfe sunnitischer Partner erhoffe – als Ziel könne somit die Bekämpfung des IS und eine Okkupation Syriens und des Iraks durch die Vereinigten Staaten ausgemacht werden. In diesem Sinne sehe auch Obama die USA als Weltordnungsmacht, verfolge allerdings eine Politik der relativen Zurückhaltung. Dabei gehe es dem US-Präsidenten vor allem darum, eine Balance zwischen den Mächten im Nahen Osten herzustellen, weshalb er auf den Dialog zwischen dem Iran und Saudi Arabien setze. Der aufgeführte Expertendiskurs zeige hohe Zustimmung zu Obamas Kurs der regionalen Balance und auch für Trumps Buck Passing, allerdings nur wenig Zustimmung für Clintons Rollback-Strategie.
Zum Abschluss des Tages kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Genuss eines Klavierkonzerts durch Jens Barnieck. Dieser zeigte den Niederschlag der aktuellen Politik in den USA in der zeitgenössischen Musik auf. Dabei wurden die Polarisierung und der damit verbundene politische Stillstand ebenso thematisiert wie der laufende Präsidentschaftswahlkampf.
Eng verbunden mit dem Thema Dr. Feickerts ging es am abschließenden Tag der Summer School mit Dr. Steffen Hagemann von der TU Kaiserslautern und seinem Vortrag zum Iran-Deal und den Beziehungen der USA zu Israel weiter. Im Jahre 2002 seien erstmals geheime Aktivitäten zur Anreicherung von Plutonium im Iran aufgedeckt worden. Mit der Wahl Ahmadinedschads zum Präsidenten im Jahre 2005 habe es ein Ende für unangemeldete Inspektionen seitens der International Atomic Energy Agency gegeben. Sein Nachfolger Rouhani indes setze erneut auf einen verstärkten Kooperationskurs und verabschiedete mit der E3 und EU+3 Gruppe den Joint Plan of Action und den Joint Comprehensive Plan of Action, der am 16. Januar 2016 in Kraft trat. Mit dieser neuen Regelung werde dem Iran eine Urananreicherung zwecks Energieversorgung gestattet. Der Kompromiss zwischen dem Iran und den USA habe jedoch nicht nur positive Reaktionen hervorgerufen: Insbesondere Israel, Saudi Arabien und die Golfstaaten kritisierten die Entscheidung vehement. Israel sehe seine Existenz durch eine mögliche Aufrüstung des Irans bedroht und auch Saudi-Arabien und die Golfstaaten fürchten eine konfessionsgebundene, expansionistische iranische Außenpolitik. Teheran hingegen führe seine eigene Verwundbarkeit sowie die Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Staaten als Argument heran. Obwohl der Iran-Deal wohl eine der markantesten Errungenschaften der Außenpolitik Obamas sein werde, habe dies zu neuen Spannungen im Nahen Osten geführt. Es werde sich zeigen, ob sich das Verhältnis der USA zu Israel und Saudi Arabien in der nächsten Regierung wieder nachhaltig verbessern wird.
Den Abschluss der Summer School machte Dr. Florian Böller, ebenfalls von der TU Kaiserslautern, zum Thema transatlantische Beziehungen. In seiner Analyse wandte er Karl W. Deutschs Konzept einer Sicherheitsgemeinschaft als ein komplexes soziales Gefüge mit gesellschaftlichen, historischen und normativen Einflüssen an. Trotz formaler Gleichheit gebe es in diesem Bündnis eine klare Hierarchie, aber auch eine pluralistische Grundordnung. Zum Konflikt komme es, wenn interne Faktoren (Ego-Part), wie etwa gesellschaftliche und politische Normen, Identitäten und Weltbilder mit denen des Alter-Parts kollidierten. Dies lasse sich anhand der Geschichte der transatlantischen Beziehungen gut aufzeigen. Während des Kalten Krieges habe es eine klare Rollenaufteilung zwischen den USA und Deutschland gegeben: Die USA fungierten als Schutzmacht des Client States Deutschland und anderer europäischer Staaten. Erst mit Ende des Kalten Krieges und der Diskussion um deutsche Auslandseinsätze zwischen 1993 und 1999 seien Brüche zwischen dem Ego-Part Deutschlands und dem Alter-Part der USA zum Vorschein gekommen. Die Diskussion um ein Burden Sharing in Afghanistan und Libyen zeige dies deutlich, so Dr. Böller. Trotz Deutschlands ideeller Zurückhaltung in Auslandseinsätzen forderten die USA eine stärkere Mitwirkung deutscher Truppen bei Militäroperationen im Ausland. Eine Verbesserung der Beziehungen und der gegenseitigen Erwartungshaltung könne allerdings in den letzten Jahren im Zuge der Kooperation der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten im Ukraine-Konflikt attestiert werden. Mit Blick auf den laufenden Wahlkampf und seine Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis können gesagt werden, dass es im Falle eines Sieges Donald Trumps wahrscheinlich zu einer abermaligen Zuspitzung des Burden Sharing-Konfliktes kommen würde. Unter Clinton hingegen könnten sich die Beziehungen durch eine stärkere Führungsrolle der USA wieder verbessern.